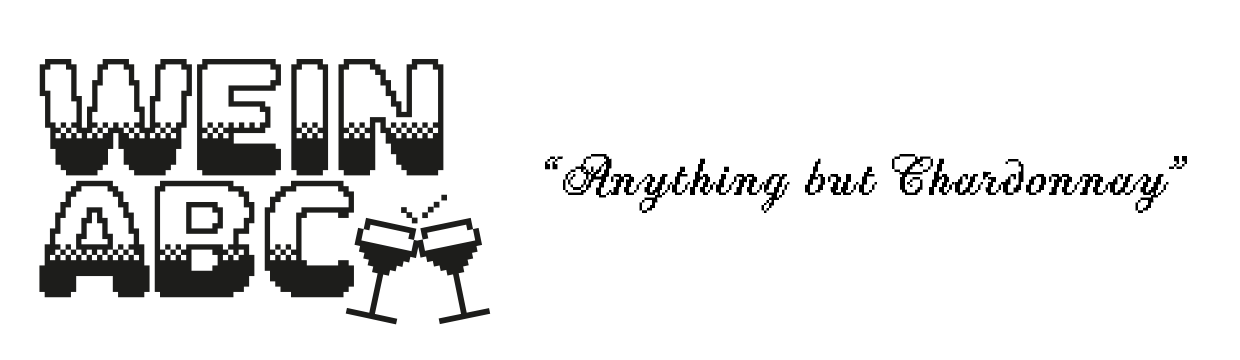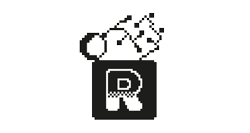| R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
RAPPEN
Sprechgesang, hier ohne Ton, ist rappen. Schwarze Pferde in der Mehrzahl sind Rappen, und ein Schweizer Franke besteht aus 100 Rappen.
Die vinophile Erklärung des Begriffs Rappen im Wörterbuch der deutschen Winzersprache lautet: Stielgerüst, an dem die Beeren hängen.
Das mehrdeutige Wort Rappen ist nicht die einzige Bezeichnung für das Stielgerüst der Weinbeeren. Der bildhafte Begriff Kamm, bzw. Traubenkämme, veranschaulicht die vielen kleinen Stiele des Gerüsts, die wie Zinken eines Kammes nach dem Rebeln, dem Abbeeren, sichtbar werden.
Ganz, mit Stiel und Stängel, werden Trauben bei der Kohlensäuremaischung oder bei der Ganztraubenpressung weiterverarbeitet. In beiden Fällen steht ein sanfter Umgang mit möglichst unversehrten Trauben im Vordergrund.
Je nach Jahrgang werden die Rappen auch extra zugegeben und mitvergoren, weil sie, wie Simone Adams es formuliert, „zur Differenzierung des Terroirs beitragen, die Tanninstruktur verfeinern sowie Tiefgründigkeit und Komplexität noch weiter steigern“.
Zu dem Thema, welche Auswirkungen die Stiele auf die Weinqualität haben, wurde von Rocio Gil-Muñoz, Encarna Gómez-Plaza eine ausführliche wissenschaftliche Untersuchung herausgegeben. Rappen sind schließlich nicht gleich Rappen! „Viele Parameter beeinflussen die Wirkung der Stiele auf den Wein, insbesondere Rebsorte, Stielzustand, Art und Weise der Einarbeitung der Stiele, Zeitpunkt ihrer Zugabe und Kontaktdauer. Andere selten berücksichtigte Faktoren können ebenfalls einen Einfluss haben, darunter Jahrgang und Reifebedingungen, die die Verholzung der Stiele beeinflussen können.“
Ob entrappt oder nicht, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Weltweit werden 70% der Beeren maschinell gelesen und bereits im Weinberg von Stock und Stiel getrennt. Für die restlichen 30% handgelesenen Trauben hat der Winzer je nach Tradition und Stilrichtung die Wahl, die Struktur und den Geschmack seiner Weine mit Rappen zu bereichern – oder eben nicht.
SCHRÖTER
Was macht wohl ein Schröter?
Damit ist schon vorweggenommen, dass ein Schröter etwas macht, nämlich schröten, bzw. schroten. Verlegen wir uns in dem Wein-ABC neuerdings auf Schrot & Korn (Begriffe aus der Münzkunde), bzw. Getreide? Schrot, in diesem Fall grob gemahlenes Getreide, dient unter anderem der Herstellung von Branntwein – immerhin ein Bezug zu einer anderen Form von Wein.
Oder geht es um das Befüllen von Patronen mittels kleinster Bleikügelchen? Als weingesellige Pazifisten veröffentlichen wir hier keine Wissenshappen, die sich mit Waffenmunition beschäftigt. Ganz im Gegenteil: Das Tragen von Waffen war dem Schröter bei seiner Arbeit gar verboten! Rechtschaffen und ehrlich mussten sie sein, die Weinschröter.
Die kurze Erläuterung bei wiktionary.org für den Schröter lautet: „Person, die schwere Weinfässer aus Handelsgründen transportiert.“ Der Begriff schroten oder auch schröten stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet das Schleifen und Ziehen eines Fasses. Ein genaueres Bild der Tätigkeit gibt die Erklärung „eine schwere Last mit Hilfe eines Schrotbaums oder einer Schrotleiter fortbewegen“. Der Beruf des Weinschröters besaß große Wichtigkeit. Sie vereinigten sich in Schröterbruderschaften, bildeten im späten Mittelalter eine eigene Zunft und organisierten sich seit dem 19. Jh. in Genossenschaften. So lange waren ihr Geschick und ihre Dienste zum Verladen und Transportieren von Weinfässern aus den engen Kellern der Winzer zum Schiffsanleger sehr gefragt. Es war eine vertrauensvolle und auch gefährliche Aufgabe.
Das zu verladene Fass, in der Regel ein Fuder mit ca. 1000 Liter Fassungsvermögen, wurde vor dem Transport erst einmal überprüft. Dafür waren auch Kenntnisse aus dem Küferhandwerk nötig. Mit mehreren Männern wurde das Fass mit Hebestangen in Position vor den Kelleraufgang gebracht. Je nach Höhe wurden zwei Schrotleitern sicher miteinander verbunden auf die Treppenstufen gelegt. Die Schrotseile wurden entweder mit Schlingen um das Fass gelegt oder bei leeren Fässern mit Haken im Spundloch des Fassbodens eingehakt. Zum Hochziehen des Fasses gab es mehrere Möglichkeiten. Mal zogen mehrere Männer im Gleichtakt mit dem Ruf „Zu gleich“ oben am Eingang an dem um einen Schrotbaum gewickelten Seil oder die Seile wurden an einer Winde befestigt und das Fass durch Drehen der Winde hochgehievt. Oben angekommen wurde das Fass auf ein Fuhrwerk verladen.
Der Schröter war bis zur Übergabe des mit Wein voll befüllten Fasses am Schiff für den sicheren Transport des kostbaren Gutes zuständig. Erst dort hat er für seine Arbeit seinen Lohn, das Schrotgeld, vom Kaufmann erhalten.
Bis Mitte des letzten Jahrhunderts waren Schröter z. B. an Schiffsanlegern am Rhein tätig. Mit der Entwicklung neuer Kellertechnik und anderer Behälter für die Weinherstellung wurde ihr ehrenhafter Beruf überflüssig. Der Begriff „Schrötertod“ bezeichnet genau diese fortschreitende Entwicklung. Der im Jahr 1988 erschienene Kriminalroman von Doris Gercke „Weinschröter, Du musst hängen“ handelt allerdings nicht vom Aussterben eines Berufszweiges entlang des Rheins, sondern deckt Verborgenes in einem Dorf im Hamburger Umland auf.
TORKELN
Na, das ist mal ein Wort, das man direkt mit Wein in Zusammenhang bringen kann! Als Tätigkeit nach reichlich Weingenuss fällt einem zu Torkeln sofort die nicht mehr ganz gradlinige Fortbewegung auf den eigenen zwei Beinen ein. Was torkeln ist, weiß man wohl! Weiß man’s?
Das Wort torquere stammt aus dem Lateinischen und bedeutet drehen, winden, umdrehen aber auch foltern, gar quälen.
Bleiben wir bei dem Drehen, nicht nur um sich selbst auf der Suche nach dem richtigen Weg, sondern der Torkel, einer Spindelpresse zum Auspressen von Maische, die bis ins späte Mittelalter verwendet wurde. Ebenfalls aus dem Lateinischen stammt „torculum“ bzw. „torcularium“, was übertragen der Kelter oder Presse oder eben der Torkel, Torggel entspricht. Um den begehrten Saft aus den angequetschten, angegorenen Reben, der Maische zu pressen, wurde mittels des bis zu 15 Meter langen, massiven Torkelbaumes und einer Spindel die druckvolle Weinpresse konstruiert. Die vielen Bauteile, die in einem schuppenartigen Torkelhaus mit vielen Mannes- und Pferdestärken zur Torkel zusammengebaut waren, wurden vom Torkelmeister und seinen ihm helfenden Knechten bedient. Die auf dem Torkelbrett (Biet) liegenden bis zu 2.000 Kilogramm Maische wurden mit einem Druck von bis zu vier Tonnen von Presshölzern gepresst. Nach 2 Stunden wurde das Pressgut noch einmal aufgemischt und erneut gepresst. Je nach Größe der Torkel und Menge des Pressgutes konnte das Pressen mehrere Tage dauern. Der Torkelmeister war angehalten das schwere Gerät und den Vorgang die ganze Zeit zu beaufsichtigen und zu begleiten – bis auf ganz kurze Austrittspausen im Torkelhäuschen.
Vom Torggeln zum Törggelen Nur noch als genussvolle Notiz zum Schluss: In die Herbstzeit und Zeit des Weinpressens gehörte vor allem in Südtirol das Zusammenkommen, um den jungen Wein oder gar noch Traubenmost zu feiern, das Törggelen. Geröstete Kastanien, Speck, Roggenbrot und andere deftige Speisen begleiten würzig den frischen Suser, Sauser. Ein gemütlicher Brauch, der heute auch ohne die beschwerliche Art des Weinpressens mittels Torkel noch gerne gepflegt wird.
UTA
Die drei klangvollen Buchstaben formen einen schönen Frauennamen, der aus dem Althochdeutschen stammend für Reichtum steht. UTA steht auch für den Beruf der wichtigen Umweltschutztechnischen Assistenten bzw. Assistentinnen. Deutlich weniger nützlich und wohlklingend, bzw. wohlschmeckend ist die Bedeutung von UTA in der Welt des Weines. UTA steht für den „untypischen Alterungston“. Keine Uta würde gerne vorzeitig so untypisch altern wollen! Die „untypische Alterungsnote“ ist ein Weinfehler. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es typische also „echte“ Alterungstöne gibt. Die werden, eben weil sie bei echt alten Weinen vorkommen, als normal bzw. als Reifetöne wertgeschätzt und nicht als Fehler betrachtet.
Während richtig alte Weißweine ehrwürdig bernsteinfarben im Glas funkeln und einen Geschmack, der als Firne bezeichnet wird, aufweisen können, sind die von UTA betroffenen Weißweine schon in der Jugend (6 Monate nach der Gärung) alt. Sie schmecken unangenehm nach dem vergessenen Fundus eines in die Jahre gekommenen Theaters. Mottenkugeln, alte Seife, nasses Sackleinen, feuchtes Pappmaschee wabern muffig in die Nase. Die wenig animierenden Beschreibungen ließen sich noch fortführen. Verantwortlich für die geschmackliche Fehlentwicklung im Wein ist 2-Aminocetophenon, AAP, dass sich beim Abbau aus dem Pflanzenhormon Indolessigsäure bilden kann. Während man den Übeltäter AAP bereits 1993 auf die Spur gekommen ist, sind die Ursachen für dessen Entstehung noch nicht endgültig geklärt. Im Jahr 2000 hat die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg zehn mögliche Fehlerquellen beim Weinanbau aufgelistet. Sehr viel detaillierter geht eine Studie des MDPI vom Juli 2023 dem Thema auf den Grund. Her nun vereinfacht die meistvermuteten Ursachen für den Weinfehler UTA: Schlechte Wasserversorgung in der Hauptvegetationsphase, eine zu frühe Lese, sprich unreifes Lesegut oder zu hoher Ertrag vor allem bei jungen Anlagen. Was kann dagegen unternommen werden?
Natürlich sollte bestenfalls sorgfältig und umweltschonend im Weinberg gearbeitet und selektiertes Traubengut für die weitere Verarbeitung im Keller verwendet werden. Der Fehler wird sozusagen mit dem Lesegut in den Keller gefahren. Dort wird dann versucht dem fehlerhaften Wein mit Ascorbinsäure seine zu früh verlorengegangene Jugend wieder einzuhauchen. Um in dem Theaterbild zu bleiben: Das Alter wird für die Premiere dick überschminkt. Nach der Vorstellung kommt die Wahrheit ans Licht – sprich ins Glas. Die Ascorbinsäure täuscht eben nur kurz die Jugend des frischen Weines vor.
VARIETAL VS. VARIETY
Zugegeben, der englische Begriff Varietals begegnet einem heutzutage nicht mehr häufig. Da die Vielfalt der mit „varie…“ startenden Worte trotzdem für Verwirrung sorgen kann, übernehmen wir hier mal die Aufklärung.
Varietal Variety Varieté – äh, das gehört nun doch wirklich nicht hierher! Oder doch? Im Französischen steht „variété“ für Abwechslung, bunte Vielfalt (nicht nur auf Schaubühnen) und hat den gleichen Ursprung wie das englische „variety“, nämlich das aus dem Lateinischen stammende Wort varietas. Varietas übersetzt auch Varietät, meint eine Auswahl, Verschiedenartigkeit, Abwechslung oder Sorten-, Vielfalt. Das bunte Bühnenspektakel trägt seinen Namen also zu Recht. Variety taucht tatsächlich auf den Rücketiketten mancher Weinflaschen auf. Gemeint ist die grape variety, also die Traubenvielfalt. Meist folgen dann in Aufzählung die verschiedenen Sorten mit Namen wie z. B. Cabernet Sauvignon und Merlot. In der Regel ist der Wein also eine Cuvée aus mehreren Rebsorten.
Varietal meint – so irreführend das Wort auch aufgebaut ist – tatsächlich nur eine einzige Sorte! Varietals oder varietal wines sind rebsortenreine Weine. Der Begriff ist gebräuchlich bei Weinen aus der neuen Welt, allen voran den USA und Australien.
Varietals – Vin de cepage – Rebsortenreiner Wein
Nachdem der Begriff sprachlich geklärt ist, lädt er doch noch zu einer genaueren Betrachtung ein. Per Definition ist je nach Herkunft rebsortenrein nicht gleich rebsortenrein! Die Gewissheit, dass ein Wein nur aus einer Rebsorte gekeltert wurde, haben Sie nur bei angekündigten 100% z.B. Chardonnay auf dem Etikett. In der alten Weinwelt, in Europa, gilt ein Wein mit 85% einer Rebsorte als Rebsortenwein und darf den Namen der Rebsorte auf dem Etikett tragen. So kann ein „Riesling“ gar mit 15% Scheurebe, Müller-Thurgau oder anderen Sorten des herstellenden Weingutes ergänzt sein. Der Winzer ist nicht verpflichtet das anzugeben.
In der neuen Welt, allen voran den USA, reichen 75% einer Rebsorte, um als Varietal zu gelten. Die Vorschriften können diesbezüglich je nach Anbaugebiet, „American Viticultural Area“ kurz AVA, etwas variieren ; ). In Kalifornien gilt bei Lagenweinen die strenge Vorschrift, dass 95% der Trauben aus der angegebenen Lage stammen müssen. Man kann davon ausgehen, dass die Lage auch nur mit einer Rebsorte bepflanzt wurde.